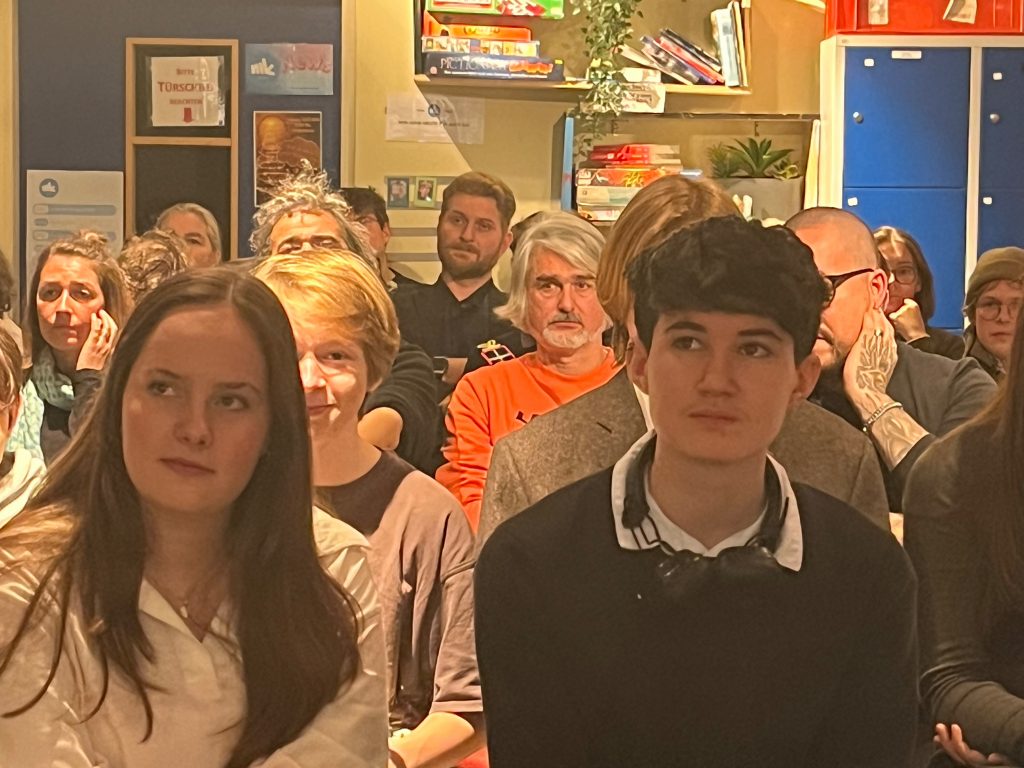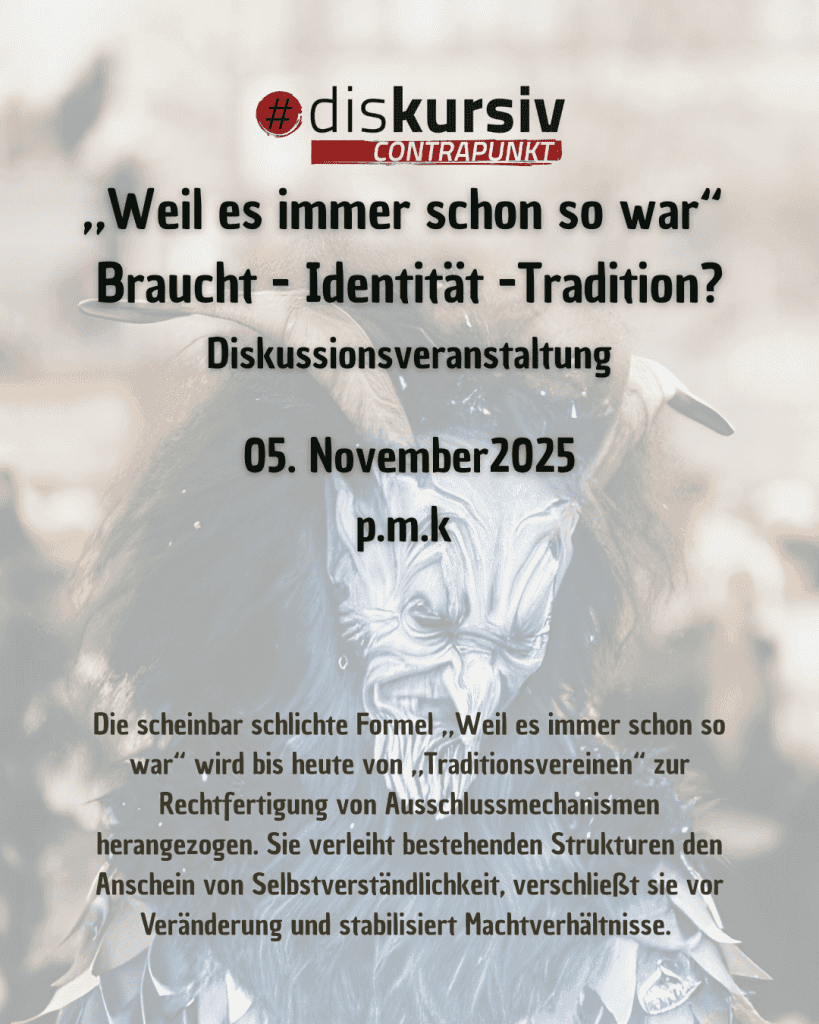Im Zukunftsvertrag 2024–2030 bekennt sich die Innsbrucker Stadtregierung ausdrücklich zu Transparenz, nachvollziehbaren Entscheidungsprozessen, verantwortungsvollem Umgang mit öffentlichen Mitteln und echter Bürger:innenbeteiligung. Diese Grundsätze sind kein rhetorischer Rahmen. Sie sind Maßstab politischen Handelns.
Genau an diesen Maßstäben muss sich der Umgang mit dem Glaskubus und der dort angesiedelten Kulturinitiative „Reich für die Insel“ messen lassen. Es geht nicht um einen Raum, sondern um Infrastruktur.
Kulturräume sind keine dekorativen Ergänzungen einer Stadt. Sie sind soziale Infrastruktur. Sie sind jene „dritten Orte“, die nicht primär Wohnen oder Arbeiten dienen, sondern Begegnung ermöglichen. Orte, an denen Menschen einander nicht als Kund:innen oder Konkurrent:innen begegnen, sondern als Mitgestaltende.
Viele kulturelle und gesellschaftliche Innovationen entstehen nicht in durchoptimierten Institutionen. Sie entstehen in Experimentierfeldern. In Zwischenräumen. In selbstorganisierten Strukturen. Der Glaskubus ist ein solcher Ort. Er ist kein fertiges Produkt. Er ist ein Möglichkeitsraum. Und genau solche Räume sind in einer Stadt wie Innsbruck, die mit steigenden Mieten und hohen Eintrittsschwellen konfrontiert ist, strukturell gefährdet. Wenn diese Räume verschwinden, entstehen sie nicht automatisch neu. Sie entstehen nur dort, wo politische Entscheidungen sie ermöglichen.
Transparenz ist kein Versprechen – sie ist Verpflichtung
Die Stadt Innsbruck hat 2025 öffentlich betont, dass neue Kulturräume in Kooperation mit der IIG entwickelt werden sollen – mit dem Ziel eines „fairen, transparenten Prozesses“. Auch in der medialen Darstellung wurde die Schaffung von mehr Raum für die alternative Szene als politisches Ziel formuliert. Diese Aussagen sind verbindliche politische Setzungen. Sie erzeugen Erwartungen.
Transparenz bedeutet in diesem Zusammenhang:
- klare Kriterien für Auswahl und Weiterführung von Standorten
- nachvollziehbare Entscheidungsgrundlagen
- dokumentierte Bewertungsprozesse
- transparente Kommunikation über Alternativen, Fristen und Perspektiven
Gerade weil im Kulturbereich häufig mit befristeten Nutzungen, individuellen Vertragsmodellen und projektbezogenen Lösungen gearbeitet wird, braucht es besonders saubere Verfahren. Ein intransparenter oder situativer Umgang mit einem bestehenden Kulturort untergräbt die Glaubwürdigkeit jener Offensive, die gleichzeitig neue Räume verspricht. Beteiligung ist kein Informationsformat – sie ist Mitgestaltung
Im Zukunftsvertrag wird Bürger:innenbeteiligung als Leitlinie definiert. Wenn über die Zukunft eines bestehenden Kulturortes entschieden wird, betrifft das nicht nur eine einzelne Initiative. Es betrifft Netzwerke, Szenen, Nutzer:innen, Anrainer:innen und die kulturelle Identität eines Stadtteils.
Beteiligung bedeutet hier:
- frühzeitige Einbindung
- transparente Diskussion von Szenarien
- nachvollziehbare Abwägung öffentlicher Interessen
Nicht nachträgliche Information, sondern Mitgestaltung im Prozess.
Gerade „Reich für die Insel“ steht exemplarisch für eine Form von Stadtproduktion von unten. Wenn solche Orte ohne klar kommunizierte Perspektive verschwinden, entsteht nicht nur räumlicher Verlust, sondern politischer Vertrauensverlust.
Kulturelle Gerechtigkeit ist soziale Gerechtigkeit
Im Zukunftsvertrag bekennt sich die Stadtregierung zur Verantwortung gegenüber allen Menschen dieser Stadt – unabhängig von sozialem Status oder ökonomischer Leistungsfähigkeit.
Freie Kulturräume sind oft die einzigen Orte, an denen Menschen ohne große finanzielle Ressourcen Sichtbarkeit erlangen können. Sie sind Labore für junge Initiativen, Underdogs, neue Formate.
Wenn der Zugang zu Raum ausschließlich über Marktmechanismen funktioniert, entsteht strukturelle Ungleichheit. Der Glaskubus muss kein Luxusobjekt sein. Er kann ein Instrument kultureller Durchlässigkeit darstellen.
Wer solche Orte als verzichtbar betrachtet, verengt den Zugang zu kultureller Teilhabe.
Innsbruck hat zuletzt öffentlich den Bedarf an alternativen Kulturräumen anerkannt. Es wurden neue Liegenschaften präsentiert, Exposés veröffentlicht, Interessensbekundungen eingefordert. Diese Schritte sind wichtig. Doch es wäre widersprüchlich, neue Räume in Aussicht zu stellen und gleichzeitig bestehende funktionierende Strukturen ohne klaren, transparenten Entwicklungsplan aufzugeben.
Die zentrale Frage lautet daher: Werden Kulturräume als austauschbare Zwischennutzungen behandelt oder als Teil demokratischer Infrastruktur?
Wenn wir akzeptieren, dass Orte wie „Reich für die Insel“ verschwinden, weil sie nicht dauerhaft abgesichert oder nicht maximal verwertbar sind, dann verschiebt sich die Logik urbaner Entwicklung dauerhaft. Dann werden Möglichkeitsräume zur Ausnahme. Dann wird kulturelle Innovation dem Zufall überlassen. Dann verlieren wir nicht nur einen Kulturraum, sondern soziale Verdichtungsräume, solidarische Netzwerke und Experimentierfelder. Und vor allem verlieren wir Vertrauen in politische Verlässlichkeit.