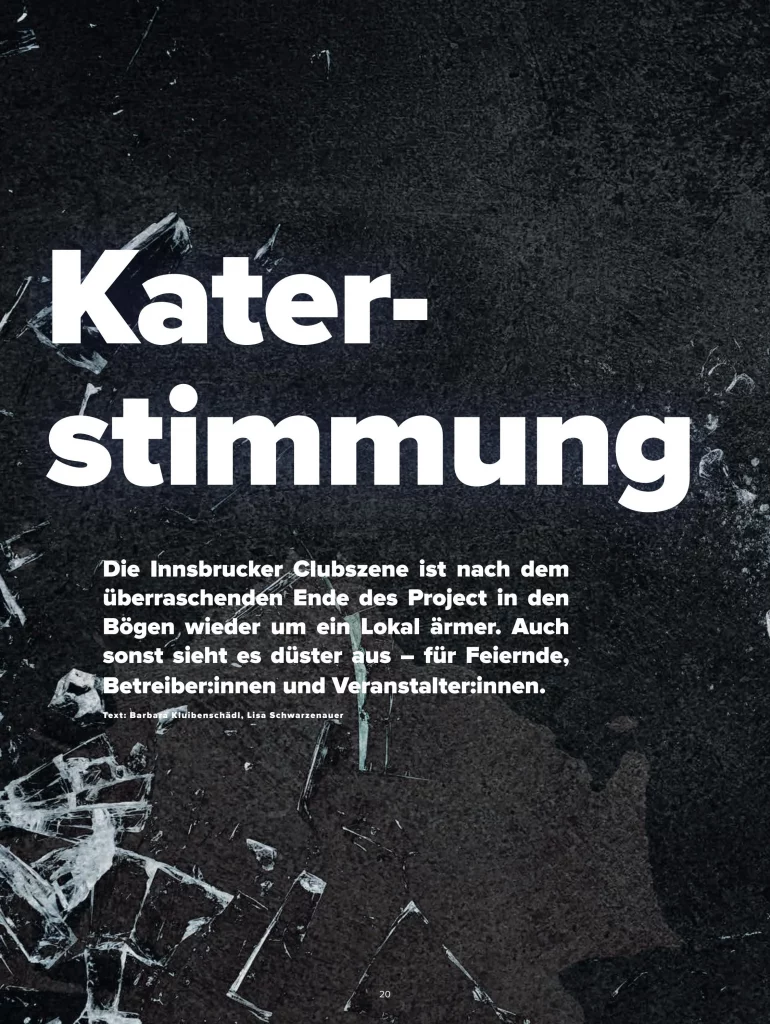Für ein lebendiges und kreatives Innsbruck
Interview mit Verena Humer (GF der KUPF) der Zeitung der KUPF, erschienen am 12.09.2024
LINK
Die Stadt Innsbruck hat im April 2024 gewählt und wird nun von einer Koalition aus JA – Jetzt Innsbruck, den Grünen und der SPÖ regiert. Was bedeutet das für Kulturpolitik und Freie Szene? Verena Humer hat bei David Prieth, der u.a. Vorstandsmitglied der TKI – Tiroler Kulturinitiativen ist, nachgefragt.
Innsbruck hat gewählt
In Innsbruck wurde am 14. und 28. April 2024 gewählt. Seit 16. Mai steht die neue Stadtkoalition. Sie besteht aus JA – Jetzt Innsbruck, den Grünen und der SPÖ. Im Stadtsenat sind Bürgermeister Johannes Anzengruber (Ja – Jetzt Innsbruck), der 1. Vizebürgermeister Georg Willi (Grüne), die 2. Vizebürgermeisterin Elisabeth Mayr (SPÖ), Stadträtin Mariella Lutz (Ja – Jetzt Innsbruck) und Stadträtin Janine Bex (Grüne) als ressortführende Mitglieder vertreten, der FPÖ obliegt keinerlei Amtsausführung. Mit dem Leitsatz „Kulturräume erhalten und neue schaffen“ werden die Kulturförder- und Unterstützungsmaßnahmen, die bereits in der Kulturstrategie 2030 festgelegt sind, im Ende Mai präsentierten Zukunftsvertrag weiter fortgeschrieben. Dem Thema „Feiern im öffentlichen Raum“ ist ein eigenes Unterkapitel gewidmet, was die Notwendigkeit von Maßnahmen in diesem Bereich unterstreicht.
Entgeltliche Einschaltung
Verena Humer: Was kann diese Regierung, was verspricht sie und was wird sie halten?
David Prieth: Positiv ist, dass das Veranstaltungsressort bei Bürgermeister Hannes Anzengruber und das Kulturressort bei Vizebürgermeister Georg Willi liegen. In dieser Kombination erwarten wir uns als Freie Szene eine produktive Arbeit sowie einen konstruktiven Austausch. Es gibt z. B. von der neuen Stadtregierung endlich auch Pläne zur Indexierung des Kulturbudgets, was wir seit Jahren gefordert haben. Dies würde sicherstellen, dass das Budget an die Inflation angepasst wird und kontinuierlich wächst. Außerdem soll ein Kulturbeirat auf Stadtebene etabliert werden, ähnlich wie in anderen Städten wie Linz. Dieser Beirat soll als Beratungsorgan fungieren und die Expertise der Kulturszene in die Politik einbringen. Diese Maßnahmen sind entscheidend für eine nachhaltige Kulturförderung.
Inwieweit hat sich die Mobilisierung der Freien Szene bei den Innsbrucker Wahlen niedergeschlagen?
Die Freie Szene hat durch Demonstrationen und Veranstaltungen im öffentlichen Raum viel Druck ausgeübt. Themen wie Feiern im öffentlichen Raum und die Schaffung von Kulturquartieren waren entscheidend und haben die Wahl beeinflusst. Es gab große Demonstrationen, wie den Tag der Kulturarbeit mit tausenden Teilnehmer*innen, die gezeigt haben, wie wichtig diese Themen für die junge Bevölkerung sind. Die Stadt hat mittlerweile eine Stelle für Veranstaltungsberatung für Freiluftkultur und Feiern im öffentlichen Raum initiiert, was ein wichtiger Schritt ist.
Die junge Freie Szene hat im Vorfeld der Wahlen gegenüber der Stadt-Politiker*innen viel mobilisiert. Die Szene hat sich stark für neue Kulturzentren und Veranstaltungsräume im öffentlichen Raum eingesetzt, nachdem in Innsbruck sehr viele Kultur- und Club-Räume geschlossen wurden. Besonders hervorzuheben sind das Kulturzentrum BALE und das Industriegelände in St. Bartlmä, die nun beide als dauerhafte Kulturorte etabliert werden sollten. Innsbruck hat ein großes Raumproblem, und diese Projekte könnten wesentlich zur Lösung beitragen.
Wie war die Kommunikation zwischen der Freien Szene und der Politik bisher?
Der Austausch war oft informell und basierte auf Eigeninitiative. Es gab Arbeitskonferenzen mit der Stadtpolitik. Auf diese gehen Projekte wie das stadt_potenziale-Förderprogramm zurück, das Kulturprojekte von einer externen Jury bewerten lässt. Mit der neuen Stadtregierung und dem Kulturbeirat erhoffen wir uns eine bessere, institutionalisierte Zusammenarbeit. Es ist wichtig, dass die Expertise der Szene ernst genommen und in die Politik integriert wird.
Was erwartest du konkret von der neuen Stadtregierung?
Wir erwarten, dass die neue Stadtregierung die Notwendigkeit der zentralen Punkte erkennt und offensiv angeht. Diese wurden bereits in der Vergangenheit in Gesprächen und in Podiumsdiskussionen thematisiert und von den Parteien, die jetzt koalieren, unterstützt. Es ist an der Zeit, dass diese Themen in die Tat umgesetzt werden.
Wie hat die Freie Szene bisher ihre Anliegen an die Politik gebracht?
Die Zusammenarbeit mit den früheren Stadtregierungen war teilweise schwierig, da hier meistens jede*r gegen jede*n gearbeitet hat. Wir hatten drei Jahre lang ein “freies Spiel der Kräfte” ohne Koalition. Dementsprechend gab es wenig Verständnis für die Bedürfnisse der Freien Szene. Die ehemalige Kulturstadträtin Uschi Schwarz war jedoch eine positive Ausnahme. Sie hatte ein gutes Verständnis für die Freie Szene und war immer offen für Gespräche. Mit der neuen Stadtregierung erhoffen wir uns eine Fortsetzung dieses offenen Austauschs. Bisher geschah dies oft informell, durch Treffen und Arbeitskonferenzen. Es gab immer wieder Initiativen wie die battlegroup for art, die sich aus verschiedenen Kulturplattformen zusammensetzt. Diese Gruppen haben Projekte wie das stadt_potenziale-Förderprogramm initiiert und sich für die Schaffung neuer Räume eingesetzt. Mit der neuen Stadtregierung und dem Kulturbeirat hoffen wir auf eine bessere, institutionalisierte Kommunikation.
Welche Rolle nimmt die FPÖ in der Kulturpolitik Innsbrucks ein?
Die FPÖ hat in Innsbruck bei der letzten Wahl schlecht abgeschnitten, was positiv für die Freie Szene ist. Sie hat regelmäßig gegen kritische Initiativen wie freie Radios, freie Medien, Kulturinitiativen gestimmt und versucht, diese zu diskreditieren. Das sind alles Initiativen, die regelmäßig von der FPÖ als nicht förderwürdig betrachtet worden sind. Da ist es natürlich positiv, wenn es jetzt Mehrheiten gibt, die die Notwendigkeit solcher Institutionen begreifen. Eine stärkere FPÖ-Präsenz wäre problematisch für Kulturinitiativen in Innsbruck. Seit einigen Monaten gibt es bei der FPÖ auch auf Landesebene Versuche, Kulturinitiativen zu diskreditieren. Es wird versucht, ein Bild von den “bösen Kulturinitiativen” zu malen. Das geht auch damit einher, dass die FPÖ auf Bundesebene seit Herbst 2023 verstärkt versucht, ominöse Argumente „gegen Linksextremismus“ anzubringen. Wir hoffen, dass wir mit der neuen Regierung vernünftig arbeiten und langfristige Projekte etablieren können.
Die FPÖ stimmt aber wie gesagt grundsätzlich gegen alle Projekte, die von uns kommen – da ist es egal, worum es im Einzelnen geht. Das betrifft die Jahresförderung der Kulturinitiative p.m.k genauso wie Diskussionsreihen, sonstige Spezialformate oder mit uns in Verbindung stehende Festivals. Sollte die Partei auf Stadtebene also mehr mitzureden haben, gehen wir natürlich davon aus, dass das für uns problematisch wäre.
Welche langfristigen Ziele verfolgt die Freie Szene?
Langfristig wollen wir sicherstellen, dass die Kulturpolitik in Innsbruck nachhaltig aufgestellt ist. Dazu gehören die genannten Punkte wie die Indexierung des Kulturbudgets, die Schaffung neuer Räume und die Etablierung eines Kulturbeirats. Wir wollen, dass die Kulturpolitik über Legislaturperioden hinweg Bestand hat und kontinuierlich weiterentwickelt wird. Es ist zudem wichtig, dass die Expertise der Szene in die Politik einfließt und ernst genommen wird.
Gibt es abschließend noch etwas, das du hervorheben möchtest?
Es ist entscheidend, dass die neue Stadtregierung die Notwendigkeit erkennt, Kultur als integralen Bestandteil der Stadtentwicklung zu sehen. Kultur schafft Identität und Gemeinschaft. Deshalb müssen wir sicherstellen, dass die kulturelle Vielfalt gefördert und unterstützt wird. Nur so kann Innsbruck zu einer lebendigen und kreativen Stadt werden, die für alle Menschen lebenswert ist.
Forderungen an die Kulturpolitik
- Schaffung neuer Räume für Kunst und Kultur: Dies umfasst sowohl Proberäume als auch Veranstaltungsorte, die dringend benötigt werden.
- Indexierung des Kulturbudgets: Um finanzielle Sicherheit zu gewährleisten und die Inflation auszugleichen, sollte das Kulturbudget regelmäßig angepasst werden.
- Etablierung eines Kulturbeirats: Dieser soll als Schnittstelle zwischen der Szene und der Politik fungieren und die kulturelle Entwicklung der Stadt unterstützen.
- Anpassung der Lärmschutzverordnung: Um mehr Freiräume für kulturelle Veranstaltungen zu schaffen, ist eine zeitgemäße Lärmschutzverordnung notwendig. Aktuell liegt es immer noch in der Zuständigkeit des zufällig anwesenden Organs festzustellen, was als “zu laut” gilt.
- Förderschiene stadt_potenziale: Dieser speziell für die Freie Szene gewidmete Kulturfördertopf, der jährlich ausgeschrieben wird und Projekte unterstützt, die sich mit dem Thema Stadt im Allgemeinen und Innsbruck im Besonderen beschäftigen, soll wieder auf €100.000 aufgestockt werden.
Die meisten dieser Forderungen wurden durch jahrelange Lobbyarbeit und verschiedene Initiativen, wie die Arbeitskonferenzen der battlegroup for art, entwickelt und forciert.